Donnerstag, 27. April 2006
Literatur. 1781: J.M.R. Lenz in Moskau
burkhardt krause, 01:00h
J.M.R. Lenz in Moskau.
Nachdem er in Sankt Petersburg auf der Suche nach einer Stellung erfolglos geblieben war, kam Lenz im September 1781 nach kurzer Tätigkeit als Hofmeister in Dorpat und einem weiteren Aufenthalt in Sankt Petersburg, nach Moskau. Dort arbeitete er als Hauslehrer, verkehrte mit russischen Freimaurern und Schriftstellern.
Er übersetzte Bücher zur russischen Geschichte ins Deutsche, doch verschlechterte sich seine psychische Situation zunehmend.
Am frühen Morgen des 24. Mai (4. 6.) 1792 wurde Lenz tot in einer Straße von Moskau gefunden.
Nachdem er in Sankt Petersburg auf der Suche nach einer Stellung erfolglos geblieben war, kam Lenz im September 1781 nach kurzer Tätigkeit als Hofmeister in Dorpat und einem weiteren Aufenthalt in Sankt Petersburg, nach Moskau. Dort arbeitete er als Hauslehrer, verkehrte mit russischen Freimaurern und Schriftstellern.
Er übersetzte Bücher zur russischen Geschichte ins Deutsche, doch verschlechterte sich seine psychische Situation zunehmend.
Am frühen Morgen des 24. Mai (4. 6.) 1792 wurde Lenz tot in einer Straße von Moskau gefunden.
... link (0 Kommentare) ... comment
Literatur. Sergej Jessenin (1895-1925)
burkhardt krause, 22:44h
Jessenin gilt als einer der bedeutenden russischen Lyriker des 20. Jahrhunderts.
Er war Sohn eines Bauern, was sich u.a. in seinem stark ausgeprägten Talent bekundet, Naturerlebnisse überzeugend in Verse umzugestalten.
Sein Leben verlief tragisch.
Es führte ihn nach Moskau und Petrograd, dann nach Westeuropa und Amerika, in Bohèmekreise, die fern seiner Beziehungen zum ländlichen Rußland und seiner Religiosität waren. Er verfiel dem Alkohol, Drogen, führte ein exzessives Leben. Verheiratet war er mit der weltberühmten amerikanischen Tänzerin Isadora Duncan, dann mit einer Enkelin Lew Tolstois und mit Sinaida Raich.
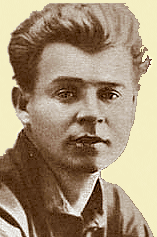
Jessenin wuchs bei seinen Großeltern auf und besuchte ein kirchliches Lehrerseminar. Mit literarischen Ambitionen ging er 1912 nach Moskau.
Er arbeitete in einer Druckerei und nahm Kontakte, die er seit 1911 unterhielt, zum Surikow-Kreis für Literatur und Musik wieder auf.
1915 reiste er von Moskau nach Petrograd und bekam über Alexander Blok Zugang zu den Symbolistenkreisen.
Sein erster Lyrikband Auferstehungszeit erschien 1916 in Petrograd. Vorherrschend ist darin die Jessenin eigene (von den Altgläubigen beeinflußte) Religiosität, die Natur und Tradition der russischen dörflichen Lebenswelten. Vielfach werden Anklänge an die Volksdichtung bemerkbar, freilich ebenso eigenständige Bildelemente.
ln Petrograd wurde er von den Symbolisten beeinflußt, insbesondere von Kljujew und Iwanow-Rasumnik. Von den Symbolisten trennte er sich indes bald.
Jessenin stand nach 1917 den Sozialrevolutionären nahe, was sich etwa in dem Gedicht Tovarišč (Der Genosse) zum Ausdruck bringt.
(Der Lyriker Iwanow-Rasumnik war der einflußreichste Literaturwissenschaftler zu Beginn des Jahrhunderts und Mentor der Symbolisten. Kurz nach der Revolution verschwand er für Jahre in sowjetischen Gefängnissen und Gulags. Während des Krieges gelang ihm die Emigration, 1946 starb er in Bayern.)
In der Verserzählung Andersland entwirft er ein nahendes Paradies der Bauern auf Erden.
1919 ging er nach Moskau und stieß zu Marienhofs literarischer Gruppe der Imaginisten, der er bedeutsame Impulse vermittelte und in entscheidender Weise prägte (durch seine „Bildtheorie“). Deren Abgrenzung gegen Proletkult und Futurismus kam seinen Vorstellungen entgegen. Er fand Anerkennung, seine Dichtung indes verlor viel von ihrer ursprünglichen Natürlichkeit. Seine Dichtungen zwischen 1921 und 1923 (Beichte eines Hooligans, Gedichte eines Skandalisten, Das Moskau der Kneipen) ist von seiner desolaten Lebenssituation geprägt.
Später kamen wieder Gedichte hinzu, in denen er das vergangene und vergehende alte Rußland dem Sowjetstaat kontrastiert.
Jessenin nannte sich 1924 einen „Fremdling im eigenen Land“, was neben der Entfremdung vom Dorf und von vielen ihm einmal nahen Menschen auch die Fremdheit gegenüber dem politischen System meinte. Schließlich suchte er aus seiner Verzweiflung Flucht im Freitod.
Nach: W. Kasack, Russische Autoren in Einzelportäts, Stuttgart 1994, S. 170-175
Auswahl seiner Lyrik unter:
http://www.litlinks.it/jx/jessenin.htm
Kein Lied nach meinem mehr, vom Dorf zu singen,
die Bretterbrücke kann nicht mehr ins Lied.
Ich seh die Birke Weihrauchkessel schwingen,
ich wohn ihr bei - der Abschiedsliturgie.
Aus meinem Leib gezogen ist die Kerze,
sie brennt herab, brennt golden und brennt stumm.
Von ihm, dem Mond, der Uhr, der Uhr dort, hölzern,
les ich es ab: Die Zeit, Sergej - herum.
Übers blaue Feld kommt er gegangen,
kommt und kommt, der eiserne, der Gast.
Rauft die Halme aus, die Abendröte tranken,
und er ballt sie in der schwarzen Faust.
Hände ihr, ihr fremden, seelenleeren,
was ich sing, wenn ihr es greift, ists hin.
Ach, um ihn, der einst der Herr hier war -: die Ähren,
sie, die wiehern, trauern einst um ihn.
Seelenmessen dann und danach Tänze,
nach dem Wiehern schwingen sie das Bein.
Jene Uhr dort, ja, die Uhr dort, hölzern,
sagts dir bald: Sergej, es ist soweit.
1920
Übersetzt von Paul Celan
Literatur: Russische Lyrik. Gedichte aus drei Jahrhunderten. Ausgewählt und eingeleitet von Efim Etkind, München 1987
Er war Sohn eines Bauern, was sich u.a. in seinem stark ausgeprägten Talent bekundet, Naturerlebnisse überzeugend in Verse umzugestalten.
Sein Leben verlief tragisch.
Es führte ihn nach Moskau und Petrograd, dann nach Westeuropa und Amerika, in Bohèmekreise, die fern seiner Beziehungen zum ländlichen Rußland und seiner Religiosität waren. Er verfiel dem Alkohol, Drogen, führte ein exzessives Leben. Verheiratet war er mit der weltberühmten amerikanischen Tänzerin Isadora Duncan, dann mit einer Enkelin Lew Tolstois und mit Sinaida Raich.
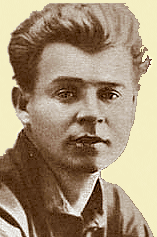
Jessenin wuchs bei seinen Großeltern auf und besuchte ein kirchliches Lehrerseminar. Mit literarischen Ambitionen ging er 1912 nach Moskau.
Er arbeitete in einer Druckerei und nahm Kontakte, die er seit 1911 unterhielt, zum Surikow-Kreis für Literatur und Musik wieder auf.
1915 reiste er von Moskau nach Petrograd und bekam über Alexander Blok Zugang zu den Symbolistenkreisen.
Sein erster Lyrikband Auferstehungszeit erschien 1916 in Petrograd. Vorherrschend ist darin die Jessenin eigene (von den Altgläubigen beeinflußte) Religiosität, die Natur und Tradition der russischen dörflichen Lebenswelten. Vielfach werden Anklänge an die Volksdichtung bemerkbar, freilich ebenso eigenständige Bildelemente.
ln Petrograd wurde er von den Symbolisten beeinflußt, insbesondere von Kljujew und Iwanow-Rasumnik. Von den Symbolisten trennte er sich indes bald.
Jessenin stand nach 1917 den Sozialrevolutionären nahe, was sich etwa in dem Gedicht Tovarišč (Der Genosse) zum Ausdruck bringt.
(Der Lyriker Iwanow-Rasumnik war der einflußreichste Literaturwissenschaftler zu Beginn des Jahrhunderts und Mentor der Symbolisten. Kurz nach der Revolution verschwand er für Jahre in sowjetischen Gefängnissen und Gulags. Während des Krieges gelang ihm die Emigration, 1946 starb er in Bayern.)
In der Verserzählung Andersland entwirft er ein nahendes Paradies der Bauern auf Erden.
1919 ging er nach Moskau und stieß zu Marienhofs literarischer Gruppe der Imaginisten, der er bedeutsame Impulse vermittelte und in entscheidender Weise prägte (durch seine „Bildtheorie“). Deren Abgrenzung gegen Proletkult und Futurismus kam seinen Vorstellungen entgegen. Er fand Anerkennung, seine Dichtung indes verlor viel von ihrer ursprünglichen Natürlichkeit. Seine Dichtungen zwischen 1921 und 1923 (Beichte eines Hooligans, Gedichte eines Skandalisten, Das Moskau der Kneipen) ist von seiner desolaten Lebenssituation geprägt.
Später kamen wieder Gedichte hinzu, in denen er das vergangene und vergehende alte Rußland dem Sowjetstaat kontrastiert.
Jessenin nannte sich 1924 einen „Fremdling im eigenen Land“, was neben der Entfremdung vom Dorf und von vielen ihm einmal nahen Menschen auch die Fremdheit gegenüber dem politischen System meinte. Schließlich suchte er aus seiner Verzweiflung Flucht im Freitod.
Nach: W. Kasack, Russische Autoren in Einzelportäts, Stuttgart 1994, S. 170-175
Auswahl seiner Lyrik unter:
http://www.litlinks.it/jx/jessenin.htm
Kein Lied nach meinem mehr, vom Dorf zu singen,
die Bretterbrücke kann nicht mehr ins Lied.
Ich seh die Birke Weihrauchkessel schwingen,
ich wohn ihr bei - der Abschiedsliturgie.
Aus meinem Leib gezogen ist die Kerze,
sie brennt herab, brennt golden und brennt stumm.
Von ihm, dem Mond, der Uhr, der Uhr dort, hölzern,
les ich es ab: Die Zeit, Sergej - herum.
Übers blaue Feld kommt er gegangen,
kommt und kommt, der eiserne, der Gast.
Rauft die Halme aus, die Abendröte tranken,
und er ballt sie in der schwarzen Faust.
Hände ihr, ihr fremden, seelenleeren,
was ich sing, wenn ihr es greift, ists hin.
Ach, um ihn, der einst der Herr hier war -: die Ähren,
sie, die wiehern, trauern einst um ihn.
Seelenmessen dann und danach Tänze,
nach dem Wiehern schwingen sie das Bein.
Jene Uhr dort, ja, die Uhr dort, hölzern,
sagts dir bald: Sergej, es ist soweit.
1920
Übersetzt von Paul Celan
Literatur: Russische Lyrik. Gedichte aus drei Jahrhunderten. Ausgewählt und eingeleitet von Efim Etkind, München 1987
... link (0 Kommentare) ... comment
Literatur. Lev Lunc (1901-1924)
burkhardt krause, 22:34h
Lev Lunc war der bedeutende theoretische Kopf der „Serapionsbrüder“.
Zusammen mit dem jüngsten der Serapionsbrüder, Veniamin Kaverin, trat Lunc für eine an der westlichen Literatur orientierte „Handlungsliteratur“ ein (fabul’nye rasskazy).
Lunc schrieb die Dramen „Vogelfrei“ (Vne zakona, 1921) und (was daran erinnert, daß er Romanistik studiert hatte) „Bertran de Born“ (Bertrand de Born, 1922). Weiter stammen von ihm mehrere Erzählungen, zwei Dramen und ein Filmszenario.
Zusammen mit dem jüngsten der Serapionsbrüder, Veniamin Kaverin, trat Lunc für eine an der westlichen Literatur orientierte „Handlungsliteratur“ ein (fabul’nye rasskazy).
Lunc schrieb die Dramen „Vogelfrei“ (Vne zakona, 1921) und (was daran erinnert, daß er Romanistik studiert hatte) „Bertran de Born“ (Bertrand de Born, 1922). Weiter stammen von ihm mehrere Erzählungen, zwei Dramen und ein Filmszenario.
... link (0 Kommentare) ... comment
Literatur. Daniil Iwanowitsch Juwatschow (Daniil Charms) (1905-1942)
burkhardt krause, 22:32h
30.12.1905, Daniil Iwanowitsch Juwatschow (Daniil Charms) geboren, gest. 2.2. 1942
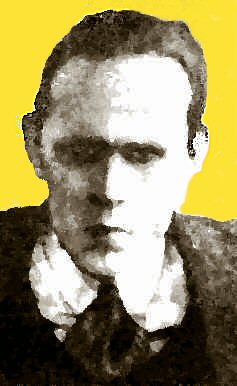
Charms benutzte etwa dreißig Pseudonyme. Der Nachname bildet sich aus englisch charm. Bis 1940 lebt Charms mit seinem Vater, einem Lehrer und Schriftsteller, der auch Mitglied der sozialrevolutionären Organisation „Volkswille“ war.
1915: Eintritt in die deutsche Schule.
1918: Die Familie verläßt St. Petersburg.
1924: Abitur; Beginn des Studiums am Elektrotechnikum.
Ab 1926: Studium der Kunstgeschichte (Abteilung Film). Mitglied des Dichterverbandes.
Ende 1927: Mit dem Dichter Aleksándr Vvedenskij und anderen gründet er OBERIU, die Vereinigung der Realen Kunst.
24. Januar 1928: OBERIU hat im Haus der Presse eine erste Veranstaltung: „Drei linke Stunden“. Es wurde das Manifest verlesen, ein Theaterstück aufgeführt und eine Filmcollage präsentiert. Charms trug (um die These der OBERIU, die Kunst sei „ein Schrank“, zu belegen) auf einem schwarz lackierten Schrank stehend Gedichte vor. Dabei war er kostümiert und geschminkt. Diese „avantgardistische“ Präsentation löste einen Skandal aus. Die Mitglieder von OBERIU werden als Klassenfeinde verurteilt.
1932: Die Gruppe wird aufgelöst.
Charms und seine Freunde schreiben Bücher für Kinder und publizieren in den Zeitschriften „Igel“, „Zeisig“ und „Glühwürmchen“.
Wegen „Beteiligung an einer antisowjetischen Vereinigung“ werden Charms und Vvedenskij am 10. Dezember 1931 verhaftet. Charms wird zu 3 Jahren Straflager in Kursk verurteilt.
1933 bis 1937 arbeitet er an Prosa, Gedichten und Theaterstücken. Der größte Teil davon wurde zu seiner Lebenszeit nie veröffentlicht. Wichtig sind für Charms 30 Kurz- und Kleinsterzählungen, die er „Fälle“ nennt. Charms und seine Freunde haben weiterhin unter Verfolgung zu leiden.
„Gestern hat mir Papa gesagt, daß mich die Not verfolgen werde, solange ich Charms bleibe“, notierte er 1936 in sein Tagebuch.
23. August 1941: Charms wird wieder verhaftet.
Seine zweite Frau rettet die Manuskripte.
Am 2. Februar 1942 verhungert Charms wahrscheinlich im Gefängnis in Leningrad.
1956 wird er rehabilitiert.
Auswahl der Gedichte unter:
http://home.arcor.de/berick/illeguan/charms3.htm
Eine interessante Website: http://www.umsu.de/charms/texte/WERK.HTM
Lied
Wir schließen unsre Augen,
Menschen! Menschen!
Wir öffnen unsre Augen,
Krieger! Krieger!
Erhebt uns über die Wasser,
Engel! Engel!
Ertränkt den Feind im Wasser,
Dämonen! Dämonen!
Wir schlossen unsre Augen,
Menschen! Menschen!
Wir öffneten unsre Augen,
Krieger! Krieger!
Gebt uns die Macht übers Wasser zu fliegen,
Vögel! Vögel!
Gebt uns den Mut im Wasser zu ertrinken,
Fische! Fische!
1935
Gegenstände und Figuren, entdeckt von Daniil Ivanowitsch Charms
1) Die Bedeutung jedes Gegenstandes ist vielfältig. Schaffen wir alle Bedeutungen außer einer ab, so machen wir allein dadurch den gegebenen Gegenstand unmöglich.
Schaffen wir auch diese letzte Bedeutung ab, so schaffen wir die Existenz des Gegenstandes selbst ab.
2) Jeder Gegenstand (leblos und vom Menschen geschaffen) hat vier FUNKTIONALE Bedeutungen und eine FÜNFTE WESENTLICHE Bedeutung.
Die ersten vier sind:
- 1) die darstellbare (geometrische) Bedeutung,
- 2) die zielgerechte, zweckbestimmte (utilitare) Bedeutung,
- 3) die Bedeutung der emotionalen Wirkung auf den Menschen,
- 4) die Bedeutung der ästhetischen Wirkung auf den Menschen. Die fünfte Bedeutung definiert sich durch das Faktum der Existenz des Gegenstandes selbst. Sie steht jenseits des Verhältnisses zwischen Gegenstand und Mensch und dient nur dem Gegenstand selbst. Die fünfte Bedeutung ist - der freie Wille des Gegenstandes.
3) Der Mensch, der mit dem Gegenstand in ein Verhältnis eintritt, erforscht dessen vier funktionale Bedeutungen. Mit ihrer Hilfe ordnet sich der Gegenstand im Bewußtsein des Menschen ein, wo er auch lebt. Würde der Mensch auf die Gesamtheit der Gegenstände mit nur drei oder vier funktionalen Bedeutungen gestoßen, er würde aufhören, ein Mensch zu sein.
Der Mensch indessen, der die Gesamtheit der Gegenstände beobachtet, die aller vier funktionalen Bedeutungen entkleidet sind, hört auf, Beobachter zu sein, und wird zu einem von ihm geschaffenen Gegenstand: Sich selbst schreibt er die fünfte Bedeutung seiner Existenz zu.
4) Die fünfte wesentliche Bedeutung hat der Gegenstand nur außerhalb und jenseits des Menschen, d.h., wenn er Vater, Haus und den Boden unter den Füßen verliert. Ein solcher Gegenstand "SCHWEBT".
5) Schwebend sind nicht nur Gegenstände, sondern auch: Gesten und Handlungen.
6) Die fünfte Bedeutung des Schrankes ist Schrank.
Die fünfte Bedeutung des Laufs ist Lauf.
7) Die unendliche Vielzahl adjektivischer und komplizierter literarischer Definitionen des Schranks vereinigt sich in dem Wort "SCHRANK"
8) Teilte man den Schrank in vier, den vier funktionalen Bedeutungen des Schranks entsprechende Disziplinen auf, so erhielten wir vier Gegenstände, die in ihrer Gesamtheit einen Schrank darstellen würden. Aber das wäre kein Schrank als solcher, und einem solchen synthetischen Schrank könnte man unmöglich die fünfte Bedeutung des Einen Schranks zuerkennen. Nur in unserem Bewußtsein zusamengesetzt, hätte er die vier wesentlichen Bedeutungen und die vier funktionalen. Und im selben Augenblick der Zusammensetzung würden außerhalb unser vier Gegenstände leben, die über je eine wesentliche und je eine funktionale Bedeutung verfügten. Stieße der Beobachter auf sie - wäre er kein Mensch mehr.
9) Der Gegenstand hat im Bewußtsein des Menschen vier funktionale Bedeutungen und die Bedeutung als Wort (der Schrank). Das Wort Schrank und der Schrank als konkreter Gegenstand existieren im System der konkreten Welt auf der gleichen Ebene wie andere Gegenstände, Steine und Leuchtkörper. Das Wort Schrank existiert im System der Begriffe auf der gleichen Ebene wie die Wörter: Mensch, Unfruchtbarkeit, Dichte, Übergang usw.
10) Die fünfte wesentliche Bedeutung des Gegenstandes im konkreten System und im System der Begriffe ist unterschiedlich. Im ersten Falle ist sie der freie Wille des Gegenstandes, im zweiten - der freie Wille des Wortes (oder des Gedankens, der durch das Wort nicht ausgedrückt wird, aber wir beschränken uns hier auf die durch Wörter ausgedrückten Begriffe).
11) Jede beliebige Reihe von Gegenständen, die die Verbindung ihrer funktionalen Bedeutungen zerstört, bewahrt die Verbindung der wesentlichen Bedeutungen, fünf an der Zahl. Eine Reihe dieser Art ist keine menschliche Reihe, sondern ist ein Gedanke der gegenständlichen Welt. Betrachtet man eine solche Reihe als ganze Größe und als neu entstandenen synthetischen Gegenstand, so können wir diesem neue Bedeutungen zuerkennen, drei an der Zahl: 1) eine geometrische, 2) eine ästhetische und 3) eine wesentliche.
12) Überführt man diese Reihe in ein anderes System, so erhalten wir eine Wortreihe, die menschlich SINNLOS ist.
http://www.umsu.de/charms/texte/WERK.HTM#2
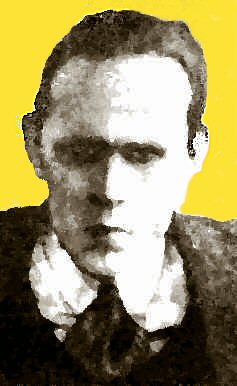
Charms benutzte etwa dreißig Pseudonyme. Der Nachname bildet sich aus englisch charm. Bis 1940 lebt Charms mit seinem Vater, einem Lehrer und Schriftsteller, der auch Mitglied der sozialrevolutionären Organisation „Volkswille“ war.
1915: Eintritt in die deutsche Schule.
1918: Die Familie verläßt St. Petersburg.
1924: Abitur; Beginn des Studiums am Elektrotechnikum.
Ab 1926: Studium der Kunstgeschichte (Abteilung Film). Mitglied des Dichterverbandes.
Ende 1927: Mit dem Dichter Aleksándr Vvedenskij und anderen gründet er OBERIU, die Vereinigung der Realen Kunst.
24. Januar 1928: OBERIU hat im Haus der Presse eine erste Veranstaltung: „Drei linke Stunden“. Es wurde das Manifest verlesen, ein Theaterstück aufgeführt und eine Filmcollage präsentiert. Charms trug (um die These der OBERIU, die Kunst sei „ein Schrank“, zu belegen) auf einem schwarz lackierten Schrank stehend Gedichte vor. Dabei war er kostümiert und geschminkt. Diese „avantgardistische“ Präsentation löste einen Skandal aus. Die Mitglieder von OBERIU werden als Klassenfeinde verurteilt.
1932: Die Gruppe wird aufgelöst.
Charms und seine Freunde schreiben Bücher für Kinder und publizieren in den Zeitschriften „Igel“, „Zeisig“ und „Glühwürmchen“.
Wegen „Beteiligung an einer antisowjetischen Vereinigung“ werden Charms und Vvedenskij am 10. Dezember 1931 verhaftet. Charms wird zu 3 Jahren Straflager in Kursk verurteilt.
1933 bis 1937 arbeitet er an Prosa, Gedichten und Theaterstücken. Der größte Teil davon wurde zu seiner Lebenszeit nie veröffentlicht. Wichtig sind für Charms 30 Kurz- und Kleinsterzählungen, die er „Fälle“ nennt. Charms und seine Freunde haben weiterhin unter Verfolgung zu leiden.
„Gestern hat mir Papa gesagt, daß mich die Not verfolgen werde, solange ich Charms bleibe“, notierte er 1936 in sein Tagebuch.
23. August 1941: Charms wird wieder verhaftet.
Seine zweite Frau rettet die Manuskripte.
Am 2. Februar 1942 verhungert Charms wahrscheinlich im Gefängnis in Leningrad.
1956 wird er rehabilitiert.
Auswahl der Gedichte unter:
http://home.arcor.de/berick/illeguan/charms3.htm
Eine interessante Website: http://www.umsu.de/charms/texte/WERK.HTM
Lied
Wir schließen unsre Augen,
Menschen! Menschen!
Wir öffnen unsre Augen,
Krieger! Krieger!
Erhebt uns über die Wasser,
Engel! Engel!
Ertränkt den Feind im Wasser,
Dämonen! Dämonen!
Wir schlossen unsre Augen,
Menschen! Menschen!
Wir öffneten unsre Augen,
Krieger! Krieger!
Gebt uns die Macht übers Wasser zu fliegen,
Vögel! Vögel!
Gebt uns den Mut im Wasser zu ertrinken,
Fische! Fische!
1935
Gegenstände und Figuren, entdeckt von Daniil Ivanowitsch Charms
1) Die Bedeutung jedes Gegenstandes ist vielfältig. Schaffen wir alle Bedeutungen außer einer ab, so machen wir allein dadurch den gegebenen Gegenstand unmöglich.
Schaffen wir auch diese letzte Bedeutung ab, so schaffen wir die Existenz des Gegenstandes selbst ab.
2) Jeder Gegenstand (leblos und vom Menschen geschaffen) hat vier FUNKTIONALE Bedeutungen und eine FÜNFTE WESENTLICHE Bedeutung.
Die ersten vier sind:
- 1) die darstellbare (geometrische) Bedeutung,
- 2) die zielgerechte, zweckbestimmte (utilitare) Bedeutung,
- 3) die Bedeutung der emotionalen Wirkung auf den Menschen,
- 4) die Bedeutung der ästhetischen Wirkung auf den Menschen. Die fünfte Bedeutung definiert sich durch das Faktum der Existenz des Gegenstandes selbst. Sie steht jenseits des Verhältnisses zwischen Gegenstand und Mensch und dient nur dem Gegenstand selbst. Die fünfte Bedeutung ist - der freie Wille des Gegenstandes.
3) Der Mensch, der mit dem Gegenstand in ein Verhältnis eintritt, erforscht dessen vier funktionale Bedeutungen. Mit ihrer Hilfe ordnet sich der Gegenstand im Bewußtsein des Menschen ein, wo er auch lebt. Würde der Mensch auf die Gesamtheit der Gegenstände mit nur drei oder vier funktionalen Bedeutungen gestoßen, er würde aufhören, ein Mensch zu sein.
Der Mensch indessen, der die Gesamtheit der Gegenstände beobachtet, die aller vier funktionalen Bedeutungen entkleidet sind, hört auf, Beobachter zu sein, und wird zu einem von ihm geschaffenen Gegenstand: Sich selbst schreibt er die fünfte Bedeutung seiner Existenz zu.
4) Die fünfte wesentliche Bedeutung hat der Gegenstand nur außerhalb und jenseits des Menschen, d.h., wenn er Vater, Haus und den Boden unter den Füßen verliert. Ein solcher Gegenstand "SCHWEBT".
5) Schwebend sind nicht nur Gegenstände, sondern auch: Gesten und Handlungen.
6) Die fünfte Bedeutung des Schrankes ist Schrank.
Die fünfte Bedeutung des Laufs ist Lauf.
7) Die unendliche Vielzahl adjektivischer und komplizierter literarischer Definitionen des Schranks vereinigt sich in dem Wort "SCHRANK"
8) Teilte man den Schrank in vier, den vier funktionalen Bedeutungen des Schranks entsprechende Disziplinen auf, so erhielten wir vier Gegenstände, die in ihrer Gesamtheit einen Schrank darstellen würden. Aber das wäre kein Schrank als solcher, und einem solchen synthetischen Schrank könnte man unmöglich die fünfte Bedeutung des Einen Schranks zuerkennen. Nur in unserem Bewußtsein zusamengesetzt, hätte er die vier wesentlichen Bedeutungen und die vier funktionalen. Und im selben Augenblick der Zusammensetzung würden außerhalb unser vier Gegenstände leben, die über je eine wesentliche und je eine funktionale Bedeutung verfügten. Stieße der Beobachter auf sie - wäre er kein Mensch mehr.
9) Der Gegenstand hat im Bewußtsein des Menschen vier funktionale Bedeutungen und die Bedeutung als Wort (der Schrank). Das Wort Schrank und der Schrank als konkreter Gegenstand existieren im System der konkreten Welt auf der gleichen Ebene wie andere Gegenstände, Steine und Leuchtkörper. Das Wort Schrank existiert im System der Begriffe auf der gleichen Ebene wie die Wörter: Mensch, Unfruchtbarkeit, Dichte, Übergang usw.
10) Die fünfte wesentliche Bedeutung des Gegenstandes im konkreten System und im System der Begriffe ist unterschiedlich. Im ersten Falle ist sie der freie Wille des Gegenstandes, im zweiten - der freie Wille des Wortes (oder des Gedankens, der durch das Wort nicht ausgedrückt wird, aber wir beschränken uns hier auf die durch Wörter ausgedrückten Begriffe).
11) Jede beliebige Reihe von Gegenständen, die die Verbindung ihrer funktionalen Bedeutungen zerstört, bewahrt die Verbindung der wesentlichen Bedeutungen, fünf an der Zahl. Eine Reihe dieser Art ist keine menschliche Reihe, sondern ist ein Gedanke der gegenständlichen Welt. Betrachtet man eine solche Reihe als ganze Größe und als neu entstandenen synthetischen Gegenstand, so können wir diesem neue Bedeutungen zuerkennen, drei an der Zahl: 1) eine geometrische, 2) eine ästhetische und 3) eine wesentliche.
12) Überführt man diese Reihe in ein anderes System, so erhalten wir eine Wortreihe, die menschlich SINNLOS ist.
http://www.umsu.de/charms/texte/WERK.HTM#2
... link (0 Kommentare) ... comment
Literatur. Lydia Kornejewna Tschukowskaja (1907-1996)
burkhardt krause, 22:27h
Lydia Tschukowskaja (1907-1996), Tochter eines Schriftstellers, hat die Zeit der Säuberungen unter Stalin erlitten.
Sie absolvierte ein Philologiestudium und arbeitete in einem Kinderbuchverlag.
Während der Zeit des Stalin-Terrors wurde ihr Mann verhaftet und erschossen.
Ihre Erzählung „Sofja Petrowna“ ist Ende der dreißiger Jahre erschienen und erzählt von den blutigen Geschehnissen der Stalinzeit.
Die dem System arglos vertrauende Protagonistin Sofia Petrowna erfährt das Schicksal einer Mutter, die wie sie an die Gerechtigkeit des Systems glaubt, bis auch sie völlig gebrochen und ernüchtert ihren begabten Sohn als „Volksfeind“ an den Gulag verliert.
Kurz bevor das Buch 1962 in Moskau erscheinen sollte, wurde es verboten. Es konnte nur im Westen veröffentlicht werden. Die Erzählung erschien ohne ihr Wissen 1967 in Zürich, Paris, London und New York gleichzeitig, erst 1988 in der Sowjetunion.
Wegen ihres Einsatzes für Alexander Solschenizyn wurde die Autorin 1974 aus dem sowjetischen Schriftstellerverband ausgeschlossen.
Sie absolvierte ein Philologiestudium und arbeitete in einem Kinderbuchverlag.
Während der Zeit des Stalin-Terrors wurde ihr Mann verhaftet und erschossen.
Ihre Erzählung „Sofja Petrowna“ ist Ende der dreißiger Jahre erschienen und erzählt von den blutigen Geschehnissen der Stalinzeit.
Die dem System arglos vertrauende Protagonistin Sofia Petrowna erfährt das Schicksal einer Mutter, die wie sie an die Gerechtigkeit des Systems glaubt, bis auch sie völlig gebrochen und ernüchtert ihren begabten Sohn als „Volksfeind“ an den Gulag verliert.
Kurz bevor das Buch 1962 in Moskau erscheinen sollte, wurde es verboten. Es konnte nur im Westen veröffentlicht werden. Die Erzählung erschien ohne ihr Wissen 1967 in Zürich, Paris, London und New York gleichzeitig, erst 1988 in der Sowjetunion.
Wegen ihres Einsatzes für Alexander Solschenizyn wurde die Autorin 1974 aus dem sowjetischen Schriftstellerverband ausgeschlossen.
... link (0 Kommentare) ... comment
Literatur. 1916: A. Lunatscharski stellt der Avantgarde mit der Zeitschrift Iskusstvo kommuny (Die Kunst der Kommune), ein eigenes Publikationsorgan zur Verfügung.
burkhardt krause, 22:17h
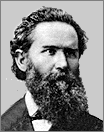
Ziele der Zeitschrift waren die Ablehnung der künstlerischen Tradition des 19. Jahrhunderts, der Akademien und Museen, die für sie Manifestationen einer überholten Kultur waren.
Majakowskij forderte z.B., nicht nur die Generäle der Weißen Armee, sondern auch Raffael und Puschkin zu „liquidieren“.
Die Avantgardisten propagierten eine am Aufbau der Gesellschaft beteiligte Kultur, sie strebten eine proletarische Kulturrevolution an. Die Partei freilich stand diesen Zielen eher zurückhaltend bis ablehnend gegenüber. Für sie war die Bewahrung des „kulturellen Erbes“ bedeutsam.
1919 mußte die Zeitschrift ihr Erscheinen wegen grundsätzlicher Meinungsverschiedenheiten zwischen den Futuristen und Lunatscharski einstellen.
... link (0 Kommentare) ... comment
Literatur. Maxim Gorkij: Rede vor der öffentlichen Versammlung der Gesellschaft ‚Kultur und Freiheit’ in Moskau
burkhardt krause, 22:13h
Maxim Gorkij: Rede vor der öffentlichen Versammlung der Gesellschaft ‚Kultur und Freiheit’ in Moskau
In: Novaja Žizn, Nr. 126 (341) 30. (17.) Juni 1918

Stalin und Gorki
Es ist überflüssig, die Notwendigkeit kultureller und erzieherischer Arbeit zu beweisen, diese Notwendigkeit ist offensichtlich; die schmutzigen Steine unserer Pflaster, der jahrhundertealte Schmutz in Herz und Hirn der Menschen flehen beredt darum. Heute sehen wir klarer als je zuvor, wie tief das russische Volk von Unwissenheit infiziert ist, in welch erschreckendem Maße ihm die Interessen des eigenen Landes fremd sind, wie primitives sich auf zivilisatorischem Gebiet verhält und wie kindlich unentwickelt sein Sinn für Geschichte und das Verständnis seines Platzes im historischen Prozeß sind.
Wenn ich ‚russisches Volk’ sage, verstehe ich darunter keineswegs nur die werktätigen Massen der Arbeiter und Bauern; nein, im spreche ganz allgemein vom Volk, von allen seinen Klassen, denn Unwissenheit und Unkultiviertheit sind der ganzen russischen Nation eigen. Aus dieser viele Millionen zählenden Masse ungebildeter Menschen, die vom Wert des Lebens keine Vorstellung haben, kann man nur die unbedeutenden paar tausend der sogenannten Intelligenz aussondern, d.h. Menschen, die sich der Bedeutung des intellektuellen Elements im historischen Prozeß bewußt sind. Diese Menschen sind, ungeachtet ihrer Fehler, das Bedeutendste, was Rußland im Laufe seiner ganzen schwierigen und widerwärtigen Geschichte hervorgebracht hat; diese Menschen waren und bleiben wirklich das Hirn und Herz unseres Landes. Ihre Fehler erklären sich durch den Boden Rußlands, der für intellektuelle Begabungen unfruchtbar ist. Wir alle sind gefühlsbegabt, sind begabt in Güte, Grausamkeit und im Unglück; unter uns gibt es viele Helden, aber nur wenige kluge und starke Menschen, die ihre Bürgerpflichten tapfer erfüllen können – unter russischen Bedingungen eine schwere Pflicht. Wir lieben Helden, wenn sie nicht gegen uns sind, aber es ist uns nicht klar, daß Heldentum nur eine Stunde oder einen Tag lang emotionale Anstrengung verlangt, Mut dagegen ein ganzes Leben lang. Unter russischen Lebensbedingungen verlangt Kulturarbeit kein Heldentum, sondern Mut, dauernde, hartnäckige Anspannung aller Kräfte der Seele. Es ist eine äußerst schwierige Angelegenheit, „Vernünftiges, Gutes und Ewiges“ auf die trügerischen russischen Sümpfe zu säen, und wir wissen schon, daß die Saaten unseres besten Blutes, des besten Saftes unserer Nerven auf den russischen Ebenen nur spärlich und kümmerlich aufgehen. Trotzdem müssen wir säen, und das ist die Aufgabe der Intellektuellen, jener Intellektuellen, die heute gewaltsam vom Leben ausgeschlossen und sogar zu Volksfeinden erklärt werden. Aber gerade sie müssen ihre schon längst begonnene Arbeit fortsetzen, die Arbeit, das Land geistig zu reinigen und zu erneuern, denn wir haben keine andere intellektuelle Kraft außer ihnen.
Man kann nun fragen: Und das Proletariat, die führende revolutionäre Klasse? Und die Bauern?
Ich glaube nicht, daß man die Masse des Proletariats eine kultivierte, intellektuelle Kraft nennen kann. Aber vielleicht ist das bequem für die Polemik mit der Bourgeoisie, um sie einzuschüchtern und sich selbst Mut zu machen; aber hier, wo sich, wie ich glaube, Menschen versammelt haben, die aufrichtig und tief um die Zukunft des Landes besorgt sind, ist das überflüssig. Das Proletariat als Masse ist nur eine physische Kraft, nicht mehr; ebenso auch die Bauernschaft. Mit der historisch jungen Arbeiter- und Bauernintelligenz ist es anders; sie ist natürlich eine geistig schöpferische Kraft, und als solche ist sie nun von ihrer eigenen Masse abgeschnitten und ebenso einsam, wie unsere alte unterdrückte Intelligenz einsam und von der Masse der Werktätigen abgeschnitten ist – unterdrückt nicht nur deshalb, weil ein Teil von ihr in Arbeitslagern war, sondern aufgrund ihrer Existenzbedingungen in Rußland, aufgrund ihres ganzen Lebens und ihrer Arbeit.
Mir scheint, daß wir zuallererst die Notwendigkeit erkennen müssen, die intellektuellen Kräfte der alten erfahrenen Intelligenz mit den Kräften der jungen Arbeiter- und Bauernintelligenz zu vereinigen. Das Schema der allrussischen, kulturellen und erzieherischen Arbeit stelle ich mir folgendermaßen vor:
Am Anfang muß die Selbstorganisierung der gesamten Intelligenz stehen, die jetzt fühlt und begreift, daß es unmöglich ist, den neuen Menschen allein durch politische Programme und politische Propaganda zu erziehen; daß die Vertiefung von Feindschaft und Haß die Menschen zur völligen Verrohung und Verwilderung führt; daß unverzügliche intensive Kulturarbeit für die Erneuerung des Landes unerläßlich ist und daß wir nur dadurch von den inneren und äußeren Feinden befreit werden.
Die Konzentration unserer Kräfte ist die wichtigste Aufgabe des Tages, und wenn wir die intellektuellen Kräfte unseres Landes konzentrieren, müssen wir die ganze Reserve der Arbeiter- und Bauernintelligenz zu der Masse der Geistesarbeiter hinzuziehen, alle jene Arbeiter und Bauern, die jetzt ohnmächtig und einsam kämpfen – in einer Umgebung, die ihnen physisch verwandt, aber geistig schon fremd ist; die verdorben ist von der zynischen Demagogie echter Fanatiker oder maskierter Abenteurer. Diese Kräfte haben eine gewaltige Bedeutung als ein eisernes Kettenglied, das die alte Intelligenz fest mit der Masse verbinden kann und ihr eine Möglichkeit gibt, die Massen unmittelbar zu beeinflussen.
Wenn die Kulturschaffenden ihre Kräfte konzentrieren und sie mit den frischen Kräften der Arbeiter- und Bauernintelligenz vereinigen, müssen sie sich bemühen, ihre eigene Arbeit zu koordinieren – das ist notwendig, um mit der Energie hauszuhalten, von der wir nicht allzuviel haben und das ist auch nötig, um doppelte Arbeit zu vermeiden.
Wenn wir das ganze Land mit einem Netz von Gesellschaften für kulturelle und erzieherische Arbeit überziehen und somit alle geistigen Kräfte des Landes sammeln, können wir überall Feuer entzünden, die unserem Land Licht und Wärme geben, die ihm helfen, gesund zu werden und auf eigenen Füßen zu stehen – rüstig, kräftig und fähig zum Aufbau und zum Schaffen. Im meine nicht eine äußerliche und mechanische Vereinigung von Menschen, die verschieden denken, sondern eine innerliche und lebendige Vereinigung all jener, die das gleiche fühlen. Nur so und nur auf diese Weise können wir zu wirklicher Kultur und Freiheit finden. (...)
Zit.n.
Maxim Gorkij, Unzeitgemäße Gedanken über Kultur und Revolution, hg., komm. u. mit e. Nachwort v. B. Scholz, Frankfurt a.M. 1974, S. 248-251
In: Novaja Žizn, Nr. 126 (341) 30. (17.) Juni 1918

Stalin und Gorki
Es ist überflüssig, die Notwendigkeit kultureller und erzieherischer Arbeit zu beweisen, diese Notwendigkeit ist offensichtlich; die schmutzigen Steine unserer Pflaster, der jahrhundertealte Schmutz in Herz und Hirn der Menschen flehen beredt darum. Heute sehen wir klarer als je zuvor, wie tief das russische Volk von Unwissenheit infiziert ist, in welch erschreckendem Maße ihm die Interessen des eigenen Landes fremd sind, wie primitives sich auf zivilisatorischem Gebiet verhält und wie kindlich unentwickelt sein Sinn für Geschichte und das Verständnis seines Platzes im historischen Prozeß sind.
Wenn ich ‚russisches Volk’ sage, verstehe ich darunter keineswegs nur die werktätigen Massen der Arbeiter und Bauern; nein, im spreche ganz allgemein vom Volk, von allen seinen Klassen, denn Unwissenheit und Unkultiviertheit sind der ganzen russischen Nation eigen. Aus dieser viele Millionen zählenden Masse ungebildeter Menschen, die vom Wert des Lebens keine Vorstellung haben, kann man nur die unbedeutenden paar tausend der sogenannten Intelligenz aussondern, d.h. Menschen, die sich der Bedeutung des intellektuellen Elements im historischen Prozeß bewußt sind. Diese Menschen sind, ungeachtet ihrer Fehler, das Bedeutendste, was Rußland im Laufe seiner ganzen schwierigen und widerwärtigen Geschichte hervorgebracht hat; diese Menschen waren und bleiben wirklich das Hirn und Herz unseres Landes. Ihre Fehler erklären sich durch den Boden Rußlands, der für intellektuelle Begabungen unfruchtbar ist. Wir alle sind gefühlsbegabt, sind begabt in Güte, Grausamkeit und im Unglück; unter uns gibt es viele Helden, aber nur wenige kluge und starke Menschen, die ihre Bürgerpflichten tapfer erfüllen können – unter russischen Bedingungen eine schwere Pflicht. Wir lieben Helden, wenn sie nicht gegen uns sind, aber es ist uns nicht klar, daß Heldentum nur eine Stunde oder einen Tag lang emotionale Anstrengung verlangt, Mut dagegen ein ganzes Leben lang. Unter russischen Lebensbedingungen verlangt Kulturarbeit kein Heldentum, sondern Mut, dauernde, hartnäckige Anspannung aller Kräfte der Seele. Es ist eine äußerst schwierige Angelegenheit, „Vernünftiges, Gutes und Ewiges“ auf die trügerischen russischen Sümpfe zu säen, und wir wissen schon, daß die Saaten unseres besten Blutes, des besten Saftes unserer Nerven auf den russischen Ebenen nur spärlich und kümmerlich aufgehen. Trotzdem müssen wir säen, und das ist die Aufgabe der Intellektuellen, jener Intellektuellen, die heute gewaltsam vom Leben ausgeschlossen und sogar zu Volksfeinden erklärt werden. Aber gerade sie müssen ihre schon längst begonnene Arbeit fortsetzen, die Arbeit, das Land geistig zu reinigen und zu erneuern, denn wir haben keine andere intellektuelle Kraft außer ihnen.
Man kann nun fragen: Und das Proletariat, die führende revolutionäre Klasse? Und die Bauern?
Ich glaube nicht, daß man die Masse des Proletariats eine kultivierte, intellektuelle Kraft nennen kann. Aber vielleicht ist das bequem für die Polemik mit der Bourgeoisie, um sie einzuschüchtern und sich selbst Mut zu machen; aber hier, wo sich, wie ich glaube, Menschen versammelt haben, die aufrichtig und tief um die Zukunft des Landes besorgt sind, ist das überflüssig. Das Proletariat als Masse ist nur eine physische Kraft, nicht mehr; ebenso auch die Bauernschaft. Mit der historisch jungen Arbeiter- und Bauernintelligenz ist es anders; sie ist natürlich eine geistig schöpferische Kraft, und als solche ist sie nun von ihrer eigenen Masse abgeschnitten und ebenso einsam, wie unsere alte unterdrückte Intelligenz einsam und von der Masse der Werktätigen abgeschnitten ist – unterdrückt nicht nur deshalb, weil ein Teil von ihr in Arbeitslagern war, sondern aufgrund ihrer Existenzbedingungen in Rußland, aufgrund ihres ganzen Lebens und ihrer Arbeit.
Mir scheint, daß wir zuallererst die Notwendigkeit erkennen müssen, die intellektuellen Kräfte der alten erfahrenen Intelligenz mit den Kräften der jungen Arbeiter- und Bauernintelligenz zu vereinigen. Das Schema der allrussischen, kulturellen und erzieherischen Arbeit stelle ich mir folgendermaßen vor:
Am Anfang muß die Selbstorganisierung der gesamten Intelligenz stehen, die jetzt fühlt und begreift, daß es unmöglich ist, den neuen Menschen allein durch politische Programme und politische Propaganda zu erziehen; daß die Vertiefung von Feindschaft und Haß die Menschen zur völligen Verrohung und Verwilderung führt; daß unverzügliche intensive Kulturarbeit für die Erneuerung des Landes unerläßlich ist und daß wir nur dadurch von den inneren und äußeren Feinden befreit werden.
Die Konzentration unserer Kräfte ist die wichtigste Aufgabe des Tages, und wenn wir die intellektuellen Kräfte unseres Landes konzentrieren, müssen wir die ganze Reserve der Arbeiter- und Bauernintelligenz zu der Masse der Geistesarbeiter hinzuziehen, alle jene Arbeiter und Bauern, die jetzt ohnmächtig und einsam kämpfen – in einer Umgebung, die ihnen physisch verwandt, aber geistig schon fremd ist; die verdorben ist von der zynischen Demagogie echter Fanatiker oder maskierter Abenteurer. Diese Kräfte haben eine gewaltige Bedeutung als ein eisernes Kettenglied, das die alte Intelligenz fest mit der Masse verbinden kann und ihr eine Möglichkeit gibt, die Massen unmittelbar zu beeinflussen.
Wenn die Kulturschaffenden ihre Kräfte konzentrieren und sie mit den frischen Kräften der Arbeiter- und Bauernintelligenz vereinigen, müssen sie sich bemühen, ihre eigene Arbeit zu koordinieren – das ist notwendig, um mit der Energie hauszuhalten, von der wir nicht allzuviel haben und das ist auch nötig, um doppelte Arbeit zu vermeiden.
Wenn wir das ganze Land mit einem Netz von Gesellschaften für kulturelle und erzieherische Arbeit überziehen und somit alle geistigen Kräfte des Landes sammeln, können wir überall Feuer entzünden, die unserem Land Licht und Wärme geben, die ihm helfen, gesund zu werden und auf eigenen Füßen zu stehen – rüstig, kräftig und fähig zum Aufbau und zum Schaffen. Im meine nicht eine äußerliche und mechanische Vereinigung von Menschen, die verschieden denken, sondern eine innerliche und lebendige Vereinigung all jener, die das gleiche fühlen. Nur so und nur auf diese Weise können wir zu wirklicher Kultur und Freiheit finden. (...)
Zit.n.
Maxim Gorkij, Unzeitgemäße Gedanken über Kultur und Revolution, hg., komm. u. mit e. Nachwort v. B. Scholz, Frankfurt a.M. 1974, S. 248-251
... link (0 Kommentare) ... comment
Literatur. 11.12.1918: Alexander Solshenizyn geboren
burkhardt krause, 22:08h
Alexander Solschenizyn wird am 11. Dezember 1918 im russischen Kislowodsk geboren und übersiedelt im Alter von sechs Jahren mit seiner Mutter nach Rostow am Don. Nach dem Besuch der höheren Schule nimmt er 1937 das Studium an der Physikalisch-Mathematischen Fakultät der Universität Rostow auf und absolviert zeitgleich einen Fernkurs am Moskauer Institut für Geschichte, Philosophie und Literatur. Der Wunsch zu schreiben und jener der Abrechnung mit einem unmenschlichen System entstehen unabhängig voneinander.
Nach dem Kriegsausbruch 1941 dient Solschenizyn als Artillerieoffizier in der Roten Armee, von 1942 bis zu seiner Verhaftung im Februar 1945 im ständigen Fronteinsatz in vorderster Linie. Einige unehrerbietige Äußerungen über Stalin in seiner Korrespondenz mit einem Schulfreund genügen für die Verhaftung in Ostpreußen von der Truppe weg und führen zu einer Verurteilung zu acht Jahren Lagerhaft am 7. Juli 1945. Während der Haft arbeitet Solschenizyn als Handlanger, Maurer und Gießer. Er lernt die Arbeit des Steineklopfens und des Metallgießens, bis er in einem Sonderlager für politische Gefangene an Krebs erkrankt und ohne Erfolg operiert wird.

Nach Verbüßung der Haft 1953 schließt sich eine dreijährige Verbannung nach Kok-Terek („Grüne Pappel“) in Kasachstan an, wo Solschenizyn als Dorfschullehrer für Mathematik und Physik arbeiten darf. Eine Strahlentherapie in der usbekischen Krebsklinik von Taschkent bringt seine Krebserkrankung zum Stillstand.
In Kok-Terek beginnt Solschenizyn im Laufe des Jahres 1955 mit einer intensiven schriftstellerischen Tätigkeit. Dieser zunächst noch geheim gehaltenen Leidenschaft widmet er sich auch nach dem Ende seiner Verbannung im Jahr darauf.
Solschenizyn wird Lehrer für Mathematik und Physik in Rjasan und beginnt mit der Niederschrift der Erzählung "Ein Tag im Leben des Iwan Denissowitsch", worin der Autor ungeschönt seine Erlebnisse während der Lagerhaft verarbeitet.
1956 beginnt er auch mit der Arbeit an seinem ersten großen Roman "Im ersten Kreis", dessen Titel sich auf den ersten Kreis der Hölle in Dantes Göttlicher Komödie beziehen wird. Durch Beschluss des Obersten Gerichtshofs der UdSSR erfolgt am 6. Februar 1957 Solschenizyns vollständige Rehabilitierung.
Infolge der Abrechnung mit dem Stalinismus durch Nikita Chruschtschow und dessen Fürsprache konnte die Erzählung "Ein Tag im Leben des Iwan Denissowitsch" 1962 in der sowjetischen Literaturzeitschrift Nowy Mir erscheinen. Diese regimekritische Publikation erregte erhebliches Aufsehen und kam einer Sensation gleich, zumal sie sich mit der stalinistischen Vergangenheit auseinandersetzte. Da Solschenizyn fortfuhr, über alles zu schreiben, was ihm auch an seiner Gegenwart missfiel, blieb die erneute Konfrontation mit dem politischen System nur eine Frage der Zeit.
Nach der Veröffentlichung von "Matrjonas Hof" - einer indirekten Kritik an der sowjetischen Gesellschaftsordnung - und nach heftigen Debatten für und wider seine Person wird Solschenizyn 1964 als Kandidat für den Lenin-Preis abgelehnt. Inzwischen beginnt der Autor mit der Niederschrift seines Romans "Krebsstation", in dem er die Substanz des kommunistischen Staatsgefüges als Krebsgeschwür und als Krankheitsherd anprangert.
In den folgenden Jahren sieht er sich zunehmend Angriffen auch aus den eigenen Reihen ausgesetzt, doch schützt ihn inzwischen seine internationale Bekanntheit vor der erneuten Verhaftung. Den Nobelpreis für Literatur des Jahres 1970 darf er nicht persönlich entgegennehmen. Bereits 1969 wird Solschenizyn aus dem Schriftstellerverband der UdSSR ausgeschlossen, an den er zwei Jahre zuvor die folgenden Zeilen gerichtet hat: "Die Aufgabe des Schriftstellers besteht nicht darin, diese oder jene Methode der Verteilung des Sozialprodukts, diese oder jene Staatsform zu verteidigen oder zu kritisieren. Der Schriftsteller wählt universale und ewige Themen, die Geheimnisse des menschlichen Herzens und Gewissens, die Begegnung des Lebens mit dem Tode, die Überwindung seelischer Schmerzen, die Gesetze der Menschlichkeit, die aus der unergründlichen Tiefe der Jahrtausende emporsteigen und erst dann verschwinden werden, wenn die Sonne verlischt ..."
In "Der Archipel Gulag", das der Autor als sein wichtigstes Werk betrachtet, zeichnet Solschenizyn umfassend die politischen Verfolgung in der Sowjetunion in allen ihren Facetten nach. Die dokumentarische Schilderung des sowjetischen Lagersystems erregt internationales Aufsehen und zieht in der Folge die Ausweisung des Autors aus der UdSSR am 14. Februar 1974 nach sich. Das zunächst in Teilen außer Landes geschmuggelte Buch kann erstmals 1973 bis 1975 in Paris erscheinen. Sein Lebenswerk hat Alexander Solschenizyn all jenen gewidmet, denen nicht genug Leben war, über dies zu erzählen:
"Vier Todeszellen gab es in dem Gefängnis, die Kinder- und die Krankenzelle auf demselben Gang! Die Todeszellen hatten je zwei Türen: eine gewöhnliche Holztür mit Guckloch und eine eiserne Gittertür, und jede Tür zwei Schlösser [...] Wand an Wand mit Nr. 43 lag ein Verhörzimmer, und nachts, wenn die Verurteilten aufs Abgeführtwerden warteten, schlugen ihnen auch noch die Schreie der Gefolterten ans Trommelfell. [...] Fürs Warten auf den Tod blieben jedem weniger als ein halber Meter im Quadrat! Obwohl doch längst bekannt ist, daß selbst ein Toter Anrecht auf zwei Meter hat – und auch das, meinte Tschechow, sei noch zu wenig..."
(Alexander Solschenizyn: Der Archipel Gulag, Bern 1974, S. 427)
Nach seiner Ausweisung aus der Sowjetunion verbringt Solschenizyn zunächst einige Zeit in der Schweiz und in Deutschland, wo er bei seinem Freund Heinrich Böll Aufnahme und Unterstützung findet. 1976 übersiedelt er in die USA, wird mit dem Freedoms Found Award der Stanford University ausgezeichnet und erhält 1978 den Doktorgrad der Harvard University.
Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion wird Solschenizyn noch im Jahre 1990 rehabilitiert, entschließt sich jedoch erst vier Jahre später zu seiner Rückkehr in die Heimat. Trotz seiner langjährigen Tätigkeit in den USA hat er sich keine fundierten Kenntnisse der englischen Sprache aneignen können, was nicht zuletzt auch damit zusammenhängen mag, dass er nach eigenen Angaben außerhalb seiner russischen Heimat nirgendwo heimisch werden konnte.
Der sich zum russisch-orthodoxen Christentum bekennende Alexander Solschenizyn lebt heute mit seiner dritten Ehefrau Natalia Svetlova nahe Moskau, von wo aus er die Entwicklung in und um Russland von Zeit zu Zeit mit kritischen Kommentaren begleitet. So übte er Kritik am Einsatz der NATO in Jugoslawien und zuletzt am Einmarsch der USA in den Irak.
Werkauswahl:
Ein Tag im Leben des Iwan Denissowitsch. Erzählung, Berlin 1963.
Der erste Kreis der Hölle. Roman, Frankfurt am Main 1968.
Krebsstation. Roman in zwei Bänden. Mit einem Vorwort von Heinrich Böll, Neuwied/Berlin 1969.
Matrjonas Hof. Mit einem Nachwort von Kay Borowsky, Stuttgart 1971.
Zwischenfall auf dem Bahnhof Kretschetowka. Erzählungen, München – Berlin 1971.
August Vierzehn. Mit einem Nachwort des Autors, Anmerkungen, einem Personenverzeichnis und historischen Karten, Neuwied – Berlin 1972.
Der Archipel Gulag, Bern 1974.
November Sechzehn, München – Zürich 1986.
Literatur- und Quellenverzeichnis:
Kasack, Wolfgang: Solshenizyn: Der erste Kreis der Hölle. In: Der russische Roman, hg. v. Bodo Zelinsky, Düsseldorf 1979, S. 381–399.
Kasack, Wolfgang: Lexikon der russischen Literatur ab 1917, Stuttgart 1976.
Krywalski, Diether: Knaurs Lexikon der Weltliteratur. Autoren – Werke – Sachbegriffe, München 1992.
Neumann-Hoditz, Reinhold: Solschenizyn, Reinbek bei Hamburg 1974.
http://www.rasscass.com/templ/te_bio.php?PID=1083&RID=1; Stand: 21.01.2006
http://de.wikipedia.org/wiki/Alexander_Solschenizyn Stand: 21.01.2006
Matthias Mühlhäuser
Nach dem Kriegsausbruch 1941 dient Solschenizyn als Artillerieoffizier in der Roten Armee, von 1942 bis zu seiner Verhaftung im Februar 1945 im ständigen Fronteinsatz in vorderster Linie. Einige unehrerbietige Äußerungen über Stalin in seiner Korrespondenz mit einem Schulfreund genügen für die Verhaftung in Ostpreußen von der Truppe weg und führen zu einer Verurteilung zu acht Jahren Lagerhaft am 7. Juli 1945. Während der Haft arbeitet Solschenizyn als Handlanger, Maurer und Gießer. Er lernt die Arbeit des Steineklopfens und des Metallgießens, bis er in einem Sonderlager für politische Gefangene an Krebs erkrankt und ohne Erfolg operiert wird.

Nach Verbüßung der Haft 1953 schließt sich eine dreijährige Verbannung nach Kok-Terek („Grüne Pappel“) in Kasachstan an, wo Solschenizyn als Dorfschullehrer für Mathematik und Physik arbeiten darf. Eine Strahlentherapie in der usbekischen Krebsklinik von Taschkent bringt seine Krebserkrankung zum Stillstand.
In Kok-Terek beginnt Solschenizyn im Laufe des Jahres 1955 mit einer intensiven schriftstellerischen Tätigkeit. Dieser zunächst noch geheim gehaltenen Leidenschaft widmet er sich auch nach dem Ende seiner Verbannung im Jahr darauf.
Solschenizyn wird Lehrer für Mathematik und Physik in Rjasan und beginnt mit der Niederschrift der Erzählung "Ein Tag im Leben des Iwan Denissowitsch", worin der Autor ungeschönt seine Erlebnisse während der Lagerhaft verarbeitet.
1956 beginnt er auch mit der Arbeit an seinem ersten großen Roman "Im ersten Kreis", dessen Titel sich auf den ersten Kreis der Hölle in Dantes Göttlicher Komödie beziehen wird. Durch Beschluss des Obersten Gerichtshofs der UdSSR erfolgt am 6. Februar 1957 Solschenizyns vollständige Rehabilitierung.
Infolge der Abrechnung mit dem Stalinismus durch Nikita Chruschtschow und dessen Fürsprache konnte die Erzählung "Ein Tag im Leben des Iwan Denissowitsch" 1962 in der sowjetischen Literaturzeitschrift Nowy Mir erscheinen. Diese regimekritische Publikation erregte erhebliches Aufsehen und kam einer Sensation gleich, zumal sie sich mit der stalinistischen Vergangenheit auseinandersetzte. Da Solschenizyn fortfuhr, über alles zu schreiben, was ihm auch an seiner Gegenwart missfiel, blieb die erneute Konfrontation mit dem politischen System nur eine Frage der Zeit.
Nach der Veröffentlichung von "Matrjonas Hof" - einer indirekten Kritik an der sowjetischen Gesellschaftsordnung - und nach heftigen Debatten für und wider seine Person wird Solschenizyn 1964 als Kandidat für den Lenin-Preis abgelehnt. Inzwischen beginnt der Autor mit der Niederschrift seines Romans "Krebsstation", in dem er die Substanz des kommunistischen Staatsgefüges als Krebsgeschwür und als Krankheitsherd anprangert.
In den folgenden Jahren sieht er sich zunehmend Angriffen auch aus den eigenen Reihen ausgesetzt, doch schützt ihn inzwischen seine internationale Bekanntheit vor der erneuten Verhaftung. Den Nobelpreis für Literatur des Jahres 1970 darf er nicht persönlich entgegennehmen. Bereits 1969 wird Solschenizyn aus dem Schriftstellerverband der UdSSR ausgeschlossen, an den er zwei Jahre zuvor die folgenden Zeilen gerichtet hat: "Die Aufgabe des Schriftstellers besteht nicht darin, diese oder jene Methode der Verteilung des Sozialprodukts, diese oder jene Staatsform zu verteidigen oder zu kritisieren. Der Schriftsteller wählt universale und ewige Themen, die Geheimnisse des menschlichen Herzens und Gewissens, die Begegnung des Lebens mit dem Tode, die Überwindung seelischer Schmerzen, die Gesetze der Menschlichkeit, die aus der unergründlichen Tiefe der Jahrtausende emporsteigen und erst dann verschwinden werden, wenn die Sonne verlischt ..."
In "Der Archipel Gulag", das der Autor als sein wichtigstes Werk betrachtet, zeichnet Solschenizyn umfassend die politischen Verfolgung in der Sowjetunion in allen ihren Facetten nach. Die dokumentarische Schilderung des sowjetischen Lagersystems erregt internationales Aufsehen und zieht in der Folge die Ausweisung des Autors aus der UdSSR am 14. Februar 1974 nach sich. Das zunächst in Teilen außer Landes geschmuggelte Buch kann erstmals 1973 bis 1975 in Paris erscheinen. Sein Lebenswerk hat Alexander Solschenizyn all jenen gewidmet, denen nicht genug Leben war, über dies zu erzählen:
"Vier Todeszellen gab es in dem Gefängnis, die Kinder- und die Krankenzelle auf demselben Gang! Die Todeszellen hatten je zwei Türen: eine gewöhnliche Holztür mit Guckloch und eine eiserne Gittertür, und jede Tür zwei Schlösser [...] Wand an Wand mit Nr. 43 lag ein Verhörzimmer, und nachts, wenn die Verurteilten aufs Abgeführtwerden warteten, schlugen ihnen auch noch die Schreie der Gefolterten ans Trommelfell. [...] Fürs Warten auf den Tod blieben jedem weniger als ein halber Meter im Quadrat! Obwohl doch längst bekannt ist, daß selbst ein Toter Anrecht auf zwei Meter hat – und auch das, meinte Tschechow, sei noch zu wenig..."
(Alexander Solschenizyn: Der Archipel Gulag, Bern 1974, S. 427)
Nach seiner Ausweisung aus der Sowjetunion verbringt Solschenizyn zunächst einige Zeit in der Schweiz und in Deutschland, wo er bei seinem Freund Heinrich Böll Aufnahme und Unterstützung findet. 1976 übersiedelt er in die USA, wird mit dem Freedoms Found Award der Stanford University ausgezeichnet und erhält 1978 den Doktorgrad der Harvard University.
Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion wird Solschenizyn noch im Jahre 1990 rehabilitiert, entschließt sich jedoch erst vier Jahre später zu seiner Rückkehr in die Heimat. Trotz seiner langjährigen Tätigkeit in den USA hat er sich keine fundierten Kenntnisse der englischen Sprache aneignen können, was nicht zuletzt auch damit zusammenhängen mag, dass er nach eigenen Angaben außerhalb seiner russischen Heimat nirgendwo heimisch werden konnte.
Der sich zum russisch-orthodoxen Christentum bekennende Alexander Solschenizyn lebt heute mit seiner dritten Ehefrau Natalia Svetlova nahe Moskau, von wo aus er die Entwicklung in und um Russland von Zeit zu Zeit mit kritischen Kommentaren begleitet. So übte er Kritik am Einsatz der NATO in Jugoslawien und zuletzt am Einmarsch der USA in den Irak.
Werkauswahl:
Ein Tag im Leben des Iwan Denissowitsch. Erzählung, Berlin 1963.
Der erste Kreis der Hölle. Roman, Frankfurt am Main 1968.
Krebsstation. Roman in zwei Bänden. Mit einem Vorwort von Heinrich Böll, Neuwied/Berlin 1969.
Matrjonas Hof. Mit einem Nachwort von Kay Borowsky, Stuttgart 1971.
Zwischenfall auf dem Bahnhof Kretschetowka. Erzählungen, München – Berlin 1971.
August Vierzehn. Mit einem Nachwort des Autors, Anmerkungen, einem Personenverzeichnis und historischen Karten, Neuwied – Berlin 1972.
Der Archipel Gulag, Bern 1974.
November Sechzehn, München – Zürich 1986.
Literatur- und Quellenverzeichnis:
Kasack, Wolfgang: Solshenizyn: Der erste Kreis der Hölle. In: Der russische Roman, hg. v. Bodo Zelinsky, Düsseldorf 1979, S. 381–399.
Kasack, Wolfgang: Lexikon der russischen Literatur ab 1917, Stuttgart 1976.
Krywalski, Diether: Knaurs Lexikon der Weltliteratur. Autoren – Werke – Sachbegriffe, München 1992.
Neumann-Hoditz, Reinhold: Solschenizyn, Reinbek bei Hamburg 1974.
http://www.rasscass.com/templ/te_bio.php?PID=1083&RID=1; Stand: 21.01.2006
http://de.wikipedia.org/wiki/Alexander_Solschenizyn Stand: 21.01.2006
Matthias Mühlhäuser
... link (0 Kommentare) ... comment
Literatur. 1921: Gründung der literarischen Gruppe der „Serapionovy brat’ja“ (nach E.T.A. Hoffmanns „Die Serapionsbrüder“, 1819/21)
burkhardt krause, 21:59h
21.2.1921 im Petrograder Dom.
Sie wandte sich gegen die seit den 20er Jahren zunehmende Funktionalisierung der Literatur durch den Proletkul’t und die bolschewistische Kulturpolitik.
Lev Lunc (1901–1924) beschrieb 1922 in seinem literarischen Manifest „Pocemu my Serapionovy brat’ja“ das „Serapiontische Prinzip“ als Ablehnung des Philistertums und des Utilitarismus in der Literatur. Literatur müsse frei sein und ohne parteiliche Einflußnahmen wirken können: „Wir glauben, daß literarische Phantastereien eine Art Wirklichkeit sind. Wir wollen keinen Utilitarismus. Wir schreiben nicht für die Propaganda. Die Kunst ist real wie das Leben, und wie das Leben selbst ist sie ohne Ziel und ohne Sinn: sie existiert, weil sie existieren muß.“
Die „Serapionisten“ wandten sich gegen die Widerspiegelungstheorie wie gegen die Vorstellung, daß Literatur einen sozialen bzw. politischen Auftrag habe. Sie müsse vielmehr ausschließlich der Aufrichtigkeit und Qualität künstlerischer Visionen verpflichtet sein.
Zu den Serapionisten gehörten u.a. die Autoren Lev Lunc, Venjamin Kaverin, Michail Zoscenko, Michail Slonimskij, Nikolaj Nikitin, Elizaveta Polonskaja, Il’ja Gruzdev, Vladimir Pozner und Viktor Sklovskij, später Vsevolod Ivanov, Konstantin Fedin und Nikolaj Tichonov.
Vor allem Sklovskij und Evgenij Zamjatin prägten die literarischen Anschauungen: Es ging ihnen um eine gegen die Alltagswelt gerichtete innovative Stilistik, irritierende Kompositionen und spannende, phantastische Sujets.
Lunc forderte von der Literatur auch, daß sie spannend zu sein habe und wies auf die westliche Abenteuerliteratur eines Cooper, Dumas und Stevenson hin („Handlungsliteratur“).
Es gab drei Stilrichtungen: den „Ornamentalismus“ (intensive Bildersprache, Skaz: Ivanov und Nikitin), die am "Phantastischen" orientierte Sujetprosa (Lunc, Kaverin, Slonimskij) und eine die spätrealistische psychologische Erzähltradition fortführende Richtung (Fedin).
Um 1927 versiegte die Hoffnung auf einen unabhängigen Weg der Literatur.
Allerdings blieb der Name „Serapionsbrüder“ bis in die 50er Jahre ein Zeichen antirevolutionären Dissidententums. Viele Texte der Gruppe konnten erst in der Perestrojkaphase veröffentlicht werden.
Sie wandte sich gegen die seit den 20er Jahren zunehmende Funktionalisierung der Literatur durch den Proletkul’t und die bolschewistische Kulturpolitik.
Lev Lunc (1901–1924) beschrieb 1922 in seinem literarischen Manifest „Pocemu my Serapionovy brat’ja“ das „Serapiontische Prinzip“ als Ablehnung des Philistertums und des Utilitarismus in der Literatur. Literatur müsse frei sein und ohne parteiliche Einflußnahmen wirken können: „Wir glauben, daß literarische Phantastereien eine Art Wirklichkeit sind. Wir wollen keinen Utilitarismus. Wir schreiben nicht für die Propaganda. Die Kunst ist real wie das Leben, und wie das Leben selbst ist sie ohne Ziel und ohne Sinn: sie existiert, weil sie existieren muß.“
Die „Serapionisten“ wandten sich gegen die Widerspiegelungstheorie wie gegen die Vorstellung, daß Literatur einen sozialen bzw. politischen Auftrag habe. Sie müsse vielmehr ausschließlich der Aufrichtigkeit und Qualität künstlerischer Visionen verpflichtet sein.
Zu den Serapionisten gehörten u.a. die Autoren Lev Lunc, Venjamin Kaverin, Michail Zoscenko, Michail Slonimskij, Nikolaj Nikitin, Elizaveta Polonskaja, Il’ja Gruzdev, Vladimir Pozner und Viktor Sklovskij, später Vsevolod Ivanov, Konstantin Fedin und Nikolaj Tichonov.
Vor allem Sklovskij und Evgenij Zamjatin prägten die literarischen Anschauungen: Es ging ihnen um eine gegen die Alltagswelt gerichtete innovative Stilistik, irritierende Kompositionen und spannende, phantastische Sujets.
Lunc forderte von der Literatur auch, daß sie spannend zu sein habe und wies auf die westliche Abenteuerliteratur eines Cooper, Dumas und Stevenson hin („Handlungsliteratur“).
Es gab drei Stilrichtungen: den „Ornamentalismus“ (intensive Bildersprache, Skaz: Ivanov und Nikitin), die am "Phantastischen" orientierte Sujetprosa (Lunc, Kaverin, Slonimskij) und eine die spätrealistische psychologische Erzähltradition fortführende Richtung (Fedin).
Um 1927 versiegte die Hoffnung auf einen unabhängigen Weg der Literatur.
Allerdings blieb der Name „Serapionsbrüder“ bis in die 50er Jahre ein Zeichen antirevolutionären Dissidententums. Viele Texte der Gruppe konnten erst in der Perestrojkaphase veröffentlicht werden.
... link (0 Kommentare) ... comment
Literatur. Jewgenij Jewtuschenko (1933 geb.)
burkhardt krause, 21:52h
18.7.1933 Der Lyriker Jewgenij Jewtuschenko geboren.

Forderung nach Freiheit für die Intellektuellen. Autobiographische Versdichtung Stancija Zima (1956; Station Sima). Sie schildert die Gewissenskonflikte eines jungen Mannes in der Sowjetunion nach Stalins Tod. Das Werk wurde von der Partei verboten, Jewtuschenko kurzfristig aus dem Komsomol ausgeschlossen.
Werke (Auswahl):
Babij Jar (1961) gegen den Antisemitismus,
Stalins Erben (1962) gegen das Wiederaufleben des Stalinismus.
Der Hühnergott (Erzählungen);
Wo die Beeren reifen (Roman, 1981);
Stirb nicht vor deiner Zeit (1994)
1946 entstand das Theaterstück:
Wenn alle Dänen Juden wären.
Es thematisiert ein weithin unbeachtetes Kapitel deutscher Geschichte im besetzten Dänemark 1943 (1998 in Deutschland aufgeführt).

Forderung nach Freiheit für die Intellektuellen. Autobiographische Versdichtung Stancija Zima (1956; Station Sima). Sie schildert die Gewissenskonflikte eines jungen Mannes in der Sowjetunion nach Stalins Tod. Das Werk wurde von der Partei verboten, Jewtuschenko kurzfristig aus dem Komsomol ausgeschlossen.
Werke (Auswahl):
Babij Jar (1961) gegen den Antisemitismus,
Stalins Erben (1962) gegen das Wiederaufleben des Stalinismus.
Der Hühnergott (Erzählungen);
Wo die Beeren reifen (Roman, 1981);
Stirb nicht vor deiner Zeit (1994)
1946 entstand das Theaterstück:
Wenn alle Dänen Juden wären.
Es thematisiert ein weithin unbeachtetes Kapitel deutscher Geschichte im besetzten Dänemark 1943 (1998 in Deutschland aufgeführt).
... link (0 Kommentare) ... comment
... nächste Seite


